Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch
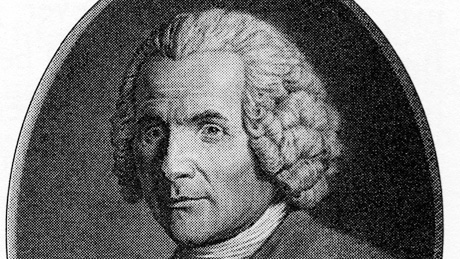
Frau Kasper, Jean-Jacques Rousseau hat die sechs Wochen, die er 1765 auf der St. Petersinsel im Bielersee verbrachte, als die glücklichsten seines Lebens bezeichnet. Worin bestand dieses Glück?
Zunächst darin, dass Rousseau sich für einige Zeit aus der bedrängten Situation, in die er sich durch seine kompromisslosen Ansichten hineinmanövriert hatte, befreien konnte. Auf der Insel fühlte er sich geschützt vor Zurücksetzungen, Angriffen und Verfolgungen. Er fand Zuflucht in der Einsamkeit, wo er sich ganz seinen Lieblingsbeschäftigungen wie dem Botanisieren und seinen Träumereien hingeben konnte.
Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschungsarbeit mit dem Buch «Les Rêveries du Promeneur Solitaire» – zu deutsch: Träumereien des einsamen Spaziergängers. In diesem 1776/77 geschriebenen, erst nach seinem Tod erschienenen Buch geht Rousseau diesem Glück, das er auf der St. Petersinsel fand, nach. Was fasziniert Sie an diesem Werk?
Es fasziniert mich, dass hier der Autor ganz bei sich selbst ist. Andere Werke Rousseaus dienen mehr der Rechtfertigung seiner Ideen. Dieser Text ist völlig frei von Zwecken und Absichten, die sich auf die Gesellschaft und ihre Institutionen beziehen. Er ist ein reines Selbstgespräch, reine Selbstverständigung.
Genauso wie bei den viel berühmteren «Confessions» handelt es sich bei «Les Rêveries du promeneur solitaire» um ein autobiografisches Buch. Was unterscheidet die beiden Werke?
Im Gegensatz zu den «Confessions», deren Niederschrift Rousseau 1770 abbrach, waren die «Rêveries» nicht mehr für eine grössere Öffentlichkeit bestimmt. Während Rousseau in den «Confessions» vergleichsweise konventionell-chronologisch sein Leben erzählt, springt er in den «Rêveries» assoziativ zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her.
Diese Prosa gehorcht in ihrem Aufbau keiner offensichtlichen Systematik, sondern folgt dem freien Fluss seiner Gedanken, was ihr einen poetischen Charakter verleiht. Rousseau ist nämlich der Überzeugung, dass der ungestörten Abfolge der Gedanken eine natürliche – oder man könnte sagen: poetische – Ordnung zugrunde liegt. Für mich ist es sein schönstes Buch.
Kann es sein, dass Rousseau seine Zeit am Bielersee rückblickend nostalgisch verklärt?
Wenn man mit dieser Frage an die «Rêveries» herangeht, wird man ihnen meines Erachtens nicht gerecht. Es ist, glaube ich, weniger entscheidend, wie sachgemäss Rousseau seine Zeit auf der St. Petersinsel darstellt, sondern was bei der Niederschrift seiner Glückserfahrungen passiert: Der Autor realisiert, dass ihn die gedankliche Vergegenwärtigung des Aufenthaltes auf der Petersinsel in dieselbe Glückseligkeit versetzt wie der Aufenthalt selbst – ja, in eine noch höhere.
An einer Stelle im Zentrum des Buches heisst es: «Indem ich nun träume, ich wäre dort, - erziele ich damit nicht letztlich den gleichen Effekt? Ich erziele sogar einen stärkeren, denn unter normalen Umständen bliebe die Träumerei abstrakt und eintönig - jetzt aber kann ich ihr noch bezaubernde Bilder hinzufügen und so richtiges Leben verleihen.»
Das Glück wird also noch grösser, indem man selbst aktiv etwas dazu beiträgt?
Genau. In den Herbstwochen auf der St. Petersinsel stellte sich der Glückszustand scheinbar nur durch die Gunst der Umstände ein, also durch ein äusseres Geschick. Das Glück, das Rousseau im Wiedererleben und Niederschreiben dieser bereits vergangenen Glücksmomente erfährt, lehrt ihn, dass er dessen Eintreten nicht passiv abwarten muss, sondern dass er zu seiner Entstehung aktiv beitragen kann.
Zwar lässt sich Glück nicht verfügbar machen oder festhalten, doch es verdankt sich gleichwohl auch der eigenen Produktivität. Diese ist getragen von einer Kraft, die der eigenen Subjektivität entspringt, aber weit über diese hinaus in die Ekstase und zu einer Erfahrung des Ganzen führt, die Rousseau mit der Erkenntnis von Wahrheit gleichsetzt.

Lassen sich Rousseaus «Rêveries» also als eine Schule des Glücks lesen?
Warum nicht, wenn man in dieser «Schule» keine simplen Anleitungen sucht. Rousseau beschreibt keine Techniken, wie das Glück zu «ergreifen» oder zu «besitzen» ist, und er entwickelt auch keine Theorie des Glücks. Zwar erörtert er die Voraussetzungen, die nötig sind, damit Glücksmomente eintreffen.
Aber das ist noch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass der Text selbst in gewisser Weise eine Figur des Glücks ist. Was als erinnernder, beschreibender Nachvollzug vergangener Glücksmomente gedacht war, wird selbst zum eigentlichen glückhaften Vorgang.
Rousseau beschreibt also nicht nur vergangene Glückszustände, sondern er vollzieht schreibend das Glück. Eine Art Glücks-Performance?
So könnte man es sagen.
Wie muss man sich ein Glück vorstellen, das sich im Schreiben vollzieht?
Als Erfahrung einer befreienden und befreiten Bewegung. Genauso stellt es Rousseau selbst dar. Er erinnert sich, wie er mit dem Kahn in den Bielersee hinausfährt, dem Plätschern der Wellen lauscht und sich dem sanften Schaukeln hingibt. Rousseau findet in diesem Bewegungsrhythmus das Vorbild für eine bestimmte Schreibweise, die nicht zweckgebunden und nicht absichtsvoll ist.
Zustände der Glückseligkeit, schrieb er, halten die Waage zwischen Bewegungsstillstand und zu heftiger Bewegtheit. Erstere gemahnt an den Tod, letztere führt zu leidenschaftlichem Besitzenwollen. Glück stellt sich nach Rousseau dann ein – und das klingt beinahe nach Buddhismus –, wenn ein natürlicher Bewegungsfluss entsteht, der nirgendwo anhaftet. Eine Bewegung also wie das Auf und Ab der Wellen im Bielersee.
Allerdings ist dieses Glück für Rousseau völlig unvereinbar mit einem Leben in der Gesellschaft, das wohl immer nur möglich ist, wenn man sich verstellt. Ohne dass Rousseau dies ausdrücklich sagt, scheint mir aber sein Schreiben, das er auch als ein Selbstgespräch versteht, den Keim einer künftigen Form von gesellschaftlicher Verständigung zu suchen.
Im Schreiben selbst findet Rousseau das Glück: Liegt darin nicht eine gewisse Ironie, wenn man bedenkt, dass Rousseau in seiner Philosophie immer das Natürliche, das Unmittelbare feiert – und der Kulturtechnik des Schreibens eher skeptisch bis ablehnend begegnet ist?
Das ist in der Tat bemerkenswert. Rousseau realisiert in den «Rêveries», dass dem Medium Schrift selbst ein Moment der Unmittelbarkeit eignet. Er entdeckt, dass ein Text nicht nur eine äussere Realität abbildet, sondern selbst etwas Reales ist, das sich einen eigenen Raum schafft. Die «Rêveries»folgen der Einsicht, dass die Sprache, in der man sich bewegt, genauso wirklich ist wie ein See, in dem man schwimmt. Das lässt sie aus heutiger Sicht so modern erscheinen.
Man macht übrigens einen Fehler, wenn man Rousseaus «Zurück zur Natur» trivial als eine Abwendung von der Kultur versteht. Rousseau denkt viel weiter. Sein «Zurück zur Natur» wendet sich gegen ein Denken, das sich von der starren Unterscheidung zwischen Kultur und Natur beherrschen lässt. Die gängige Ansicht der Aufklärung von Natur als Gegensatz zur Kultur lehnt er als eine denaturierte Auffassung von Natur ab. Nichts zeigt dies deutlicher als die «Rêveries», die unter dem Schreiben eine Bewegung verstehen, in der Körperlichkeit und Denken untrennbar verbunden sind.
Es hat also Methode, wenn der Autor der «Rêveries» sich selbst als einen «Promeneur», einen «Spaziergänger», tituliert?
Ja. Rousseau knüpft an die peripathetische Schule im antiken Griechenland an, die im Gehen eine Analogie zum Denken sah. Das Spazieren bei Rousseau bezeichnet dabei eine besondere, eine nicht zweckgebundene Gehweise. Das entspricht einer zweckfreien, schweifenden, nicht-systematischen Denkform. Das spazierende Denken befreit auf sanfte Weise von den Zwängen der Rationalität.