Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch
Maya ist eine selbständige und selbstbewusste junge Frau, die als Yoga-Lehrerin in der Schweiz, in London und in Indien ihr eigenes Leben lebt. Ihre jetzige Lebensweise musste sich die Tochter aus einer indischen Familie hart erkämpfen. In der mittelständischen schweizerischen Umgebung, in der sie aufwuchs, war «Indianness» aus ihrer Sicht gleich ein doppeltes Korsett, von dem sie sich befreien musste, wollte sie in ihrer schweizerischen Umgebung akzeptiert werden.
Einerseits brachte die Schweizer Gesellschaft fremden Sitten und Gesichtern wenig Verständnis entgegen. Der Druck, möglichst «schweizerisch» zu sein, war entsprechend hoch. Andererseits erschwerten ihr die strengen indischen Regeln des Elternhauses den Umgang mit ihren Kolleginnen und Kollegen.
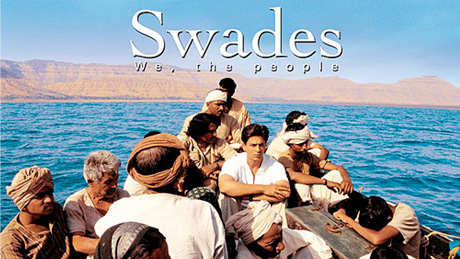
In dieser Situation lehnte sich Maya gegen die indischen Eltern auf und zog aus. Auf einer Reise nach Indien kam sie mit der Philosophie und Praxis des Yoga in Berührung; eine Begegnung, die ihr erlaubte, ihre indische Herkunft auf eine neue Weise zu erfahren. Heute – als Yoga-Lehrerin – ist es gerade diese «Indianness», ihre Verwurzelung in der indischen Kultur, die ihr Anerkennung bringt und sie prädestiniert, das im Westen zunehmende Interesse an der traditionellen indischen Yoga-Kultur zu vermitteln.
Der ambivalente Umgang Mayas mit ihrer Herkunft zeigt die Spannungsfelder auf, in denen Menschen stehen, die als Diaspora in fremden Kulturen leben. Diese Spannungen und die sich daraus ergebenden Transfer- und Übersetzungsleistungen, die Diaspora-Mitglieder ständig erbringen müssen, sind zentral für die Übertragung von kulturellen Konzepten und Praktiken über Kulturgruppen hinweg. Davon ist Andreas Kaplony, Orientalist an der Universität Zürich, überzeugt: «Taxifahrer, nicht Gelehrte oder Reisende spielen beim Austausch zwischen Kulturen die tragende Rolle.»
In der Diaspora passiert das, was hier in der Politik meist einseitig nur unter dem Schlagwort «Integration» diskutiert wird. Der von Kaplony und Mareile Flitsch, Ethnologie-Professorin und Direktorin des Völkerkundemuseums, organisierte Workshop «Entangled in Multiple Tongues» zeigte dagegen für einmal quasi die Innenperspektive der Diaspora auf. Dies über Disziplinen und Zeiten hinweg, von der frühen jüdischen Diaspora im Hellenismus bis zu den Biographien indischer Migrantinnen und Migranten der zweiten Generation, deren Lebensentwürfe Rohit Jain, Doktorand am Universitären Forschungsschwerpunkt «Asien und Europa», untersucht.
Während «Integration» das Bild einer einseitigen Anpassung vermittelt, oder zumindest mit diesem Unterton in der politischen Diskussion verwendet wird, so ist der Kulturtransfer immer ein Austausch in zwei Richtungen, wie Kaplony betont. Dabei ist der Platz, den der Einzelne zwischen diesen beiden Kulturen einnimmt, freiwillig gewählt. «Es ist mein Entscheid, neben meiner schweizerischen Identität auch noch meine ungarische Identität zu pflegen», sagt Kaplony, der als Kind eines ungarischen Vaters in der Schweiz aufgewachsen ist.

Ein Entscheid, den Mitglieder der arabischen Schicht in der christlich-byzantinisch geprägten Gesellschaft Syriens im 6. Jahrhundert nach Christus auch schon bewusst gefällt haben, wie Kaplony bei der Erforschung zweisprachiger griechisch-arabischer Inschriften und Dokumente aus der Zeit zwischen 550 und 750 erfahren hat. Gemeinsam mit dem Florentiner Gräzisten Raffaele Luiselli hat er beispielsweise die Inschrift einer Kirche in Petra analysiert, mit welcher der Kirchen-Stifter nicht nur als Christ, sondern auch prononciert als Mensch arabischer Herkunft auftritt.
Griechisch-arabische Steuererlasse aus späterer Zeit sind besonders interessant, weil sie aufzeigen, wie der Kulturtransfer passiert, wenn die Diaspora eine Oberschicht umfasst. Denn in der Regel muss eine Diaspora um ihre soziale Anerkennung kämpfen. In den von Kaplony und Luiselli untersuchten Dokumenten geht die griechisch-byzantinisch geprägte Verwaltung auf die arabische und islamische Identität der Empfänger ein: arabische Schrift und Sprache, arabische Zeitrechnung und Namenskonventionen werden verwendet und zu Beginn wird Gott in einer standardisierten islamischen Formel angerufen. Derselbe Inhalt wird hier sozusagen für zwei Kulturtraditionen verständlich aufbereitet.
In einem ganz anderen Umfeld sprach sich der Jurist Patrick Brozzo für einen offenen und pragmatischen Umgang mit unterschiedlichen Traditionen und Kulturen aus. Brozzo untersucht in seiner Dissertation jüdisches und islamisches im Vergleich zum Schweizer Eherecht. Seine – im aktuellen gesellschaftlichen und politischen Kontext durchaus brisante – Leitfrage dabei: Gibt es Elemente des islamischen oder jüdischen Rechts, die in das schweizerische Eherecht einfliessen könnten?
In der Schweiz ist im Gegensatz zu anderen westlichen Ländern einzig die zivile Heirat vor dem Standesamt rechtlich verbindlich. Religiöse Heiraten sind zwar erlaubt, allerdings erst und nur nach einer zivilen Heirat. Spezifische Regelungen, etwa relativ komplizierte Abmachungen im jüdischen Eherecht über die Scheidung, können vor schweizerischen zivilen Gerichten nicht eingeklagt werden.
Hier sieht Brozzo Möglichkeiten zur Öffnung der Schweizer Rechts, die die Situation von Diaspora-Gesellschaften berücksichtigen. Allerdings, so betonte er, dürften dadurch zentrale Werte des schweizerischen Rechtssystems, etwa die Gleichstellung von Frau und Mann, nicht unterlaufen werden.
Gerade an dieser Frage zeigt sich, dass eine vertiefte Auseinandersetzung mit der jeweiligen Kultur die Grundlage für ein Zusammenleben und einen fruchtbaren Austausch zwischen Diaspora und der sie beherbergenden Kultur ist. Denn auch die Organisation und Einrichtung des Alltags prägt und definiert das Wesen und Selbstverständnis eines Menschen, wie Mareile Flitsch am Beispiel des Essverhaltens aufzeigte. Veränderungen in diesen Verhaltensmustern stellen einen tiefgreifenden Eingriff in die kulturelle Identität einer Gemeinschaft oder eines Menschen dar.
Die Autonomie, zu essen, was und wie man zu essen gewohnt ist, ist deshalb für die Menschen sehr wichtig. Eine Beschränkung wird als massiver Eingriff in die persönliche Freiheit erfahren, vor allem, weil im Bereich der Nahrung auch Ekel oder Tabus eine wichtige Rolle spielen, so Flitsch.
Vor diesem Hintergrund etwa seien Proteste von Asylbewerbenden in Deutschland zu verstehen, die sich gegen die Essensauswahl in den Asylbewerberheimen richteten. Die Asylbewerber wollten dabei nicht mehr oder besseres Essen, sondern lediglich eine Auswahl, die dem entspricht, was in ihrer herkömmlichen Kultur bekannte Lebensmittel sind. Milchprodukte beispielsweise – bei uns wichtiger Bestandteil des Speiseplans – lösen in vielen Kulturen Ekel aus und sind nicht als Nahrungsmittel anerkannt.
Das Rezept gegen solche Missverständnisse ist gegenseitiges Interesse und Aufklärung. «Hier kann die Wissenschaft der Gesellschaft und Politik Angebote machen», sagt Mareile Flitsch. Ob sie aufgenommen werden, ist eine andere Geschichte.