Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch
Manche Menschen erinnern sich besser an emotionale Ereignisse als andere. Die beiden Forscher Dominique de Quervain von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich und Andreas Papassotiropoulos von der Universität Basel haben nun herausgefunden, dass die Unterschiede im emotionalen Erinnerungsvermögen unter anderem genetischen Ursprungs sind. «Mitverantwortlich für diese Unterschiede ist eine genetisch verankerte Variante des ADRA2B Rezeptors, welcher als Andockstelle für den Neurotransmitter Noradrenalin dient», erläutert Dominique de Quervain.

Dass Noradrenalin bei der emotionalen Erinnerung eine Rolle spielt, war bereits aus Tierversuchen bekannt. In ihren Untersuchungen stellten de Quervain und Papassotiropoulos nun fest, dass Menschen, die eine bestimmte Variante des Gens ADRA2B aufweisen, eine überdurchschnittlich gute Erinnerung an gefühlsbetonte Momente und Situationen haben.
Um die Wirkung der Genvariante nachzuweisen, haben die Gedächtnisforscher die entsprechenden DNA-Abschnitte von 435 Schweizer Probanden bestimmt. Mit den Probanden wurde ein Gedächtnistest durchgeführt, wobei sie jeweils vier Sekunden Zeit hatten, um sich ein Foto einzuprägen. Insgesamt waren es dreissig Fotos, darunter zehn neutrale Darstellungen, wie etwa Menschen im Gespräch oder auf der Strasse. Zehn Fotos zeigten positive Szenen, einen Grossvater im Spiel mit seinen Enkelkindern oder ein Hochzeitspaar. Zusätzlich wurden zehn negative Bilder vorgelegt, die eine Verletzung oder einen Unfall darstellten.
«Durchschnittlich wurden viel mehr emotionale als neutrale Bilder erinnert, allerdings nicht bei allen Versuchspersonen im gleichen Masse», bilanziert de Quervain. «Versuchspersonen mit der Rezeptorvariante erinnerten sich an besonders viele emotionale Bilder.» Auf die Erinnerungsfähigkeit der neutralen Bilder hatte der genetische Unterschied indes keinen Einfluss. Auch liessen sich keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern nachweisen.
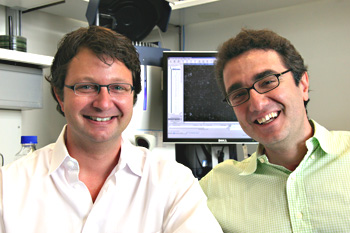
Die Genvariante spielt auch bei traumatischen Erinnerungen eine wichtige Rolle, wie die Forscher in einer zweiten Untersuchung herausfanden. De Quervain und Papassotiropoulos untersuchten zusammen mit Konstanzer Wissenschaftlern die Effekte der Rezeptorvariante bei Überlebenden des Genozids in Ruanda. Dabei zeigte sich, dass sie für die Stärke der quälenden Erinnerungen an die furchtbaren Ereignisse während des Bürgerkrieges mitverantwortlich war. Traumatische Erinnerungen gehören zu den Hauptsymptomen der posttraumatischen Belastungsstörung. Rund zwei Drittel der Untersuchten litten an dieser Angsterkrankung.
Während der gedächtnisfördernde Effekt von Emotionen einerseits biologisch Sinn macht, da erlebte Gefahrensituationen künftig eher vermieden werden können, gibt es auch eine Kehrseite: «Der Preis, den man für diese positiven Effekte zu bezahlen hat ist, dass sich traumatische Erlebnisse so tief in unser Gedächtnis eingraben können, dass sie in Form quälender traumatischer Erinnerungen und Alpträumen weiter existieren», sagt de Quervain.
Ob die aktuelle Entdeckung der genetischen Zusammenhänge des emotionalen Gedächtnisses auch therapeutisch genutzt werden kann, können die Forscher derzeit noch nicht sagen. Im Moment gehe es noch darum, die neurobiologischen Grundlagen von Emotionen und Gedächtnis besser zu verstehen, meint de Quervain. Doch ihr nächstes Ziel – die gezielte Entwicklung neuer Therapiestrategien zur Behandlung von Gedächtnisstörungen – steht den Forschern schon vor Augen.