Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch

Herr Helbling, im Rahmen des Nationalfondsprojekts 40+ untersuchen Sie die Hintergründe der Einbürgerungspraxis in der Schweiz und ihren Bezug zur Fremdenfeindlichkeit. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Einbürgerungspraxis und Fremdenfeindlichkeit?
Marc Helbling: Das ist eine Frage des Begriffs: Unsere Definition von Fremdenfeindlichkeit ist sehr neutral. Jede Gruppe – sei es eine Nation, sei es der Freundeskreis – funktioniert über Ausschliessungen. Keine Gruppe nimmt jeden auf, der aufgenommen werden will. Unter Fremdenfeindlichkeit verstehen wir ganz allgemein Ausschliessungsmechanismus gegenüber Ausländern – ein Prinzip also, das Teil jedes Nationalstaates ist.
Die Frage ist jetzt natürlich, wie grosszügig beziehungsweise wie restriktiv dieser Mechanismus jeweils ist und von welchen Faktoren er beeinflusst wird. Sie steht im Mittelpunkt unserer Studie.
Was sind die Hintergründe Ihrer Studie, welches die bisherigen Resultate?
In der wissenschaftlichen Literatur wird oft argumentiert, dass wirtschaftliche und soziale Faktoren für das Verhalten gegenüber Ausländern entscheidend seien. Wenn es den Leuten wirtschaftlich schlecht geht oder in ihrem Umfeld viele Ausländer leben, heisst es, werden mehr Einbürgerungsgesuche abgelehnt.
Wir konnten nun aufzeigen, dass drei andere Faktoren für die Ablehnung viel entscheidender sind: Erstens fällt das Verfahren, mit dem über ein Gesuch befunden wird, ins Gewicht. Hier steht die Frage im Vordergrund, ob mittels Urnenabstimmung oder in anderen Verfahren an öffentlichen Gemeindeversammlungen, im lokalen Parlament oder innerhalb der Exekutive entschieden wird.
Zweitens ist die Meinung von dominanten Politikern von Belang. Hier konnten wir einen klaren Einfluss der SVP feststellen. Drittens ist das jeweilige Staatsverständnis für die Ablehnungsquote relevant. Faktoren wie Arbeitslosigkeit und Ausländeranteil haben dagegen keinen direkten Effekt. Sie führen nicht automatisch zu einer hohen Ablehnungsquote. Das heisst aber natürlich nicht, dass sie völlig belanglos sind. Sie können indirekt über die Instrumentalisierung durch Gemeindepolitiker eine Rolle spielen.
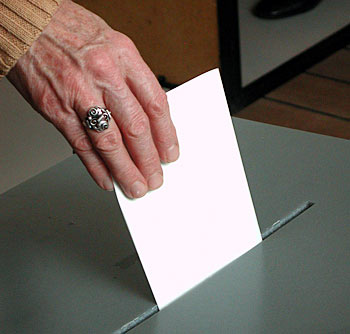
Sie zeigen auf, dass die Ablehnungsquote um 23 Prozent steigt, wenn Gemeinden an der Urne über Einbürgerungen befinden. Die Anonymität solcher Abstimmungen scheint ein wesentlicher Faktor dafür zu sein. Weshalb?
Die Gründe können wir natürlich nicht im Detail analysieren. Sicher kann die Politik bei Urnenabstimmungen – bei denen die Bürgerinnen und Bürger ihre Argumente ja nicht öffentlich zu vertreten brauchen – besser gegen Einbürgerungen mobilisieren. Der Effekt ist aber nicht überall derselbe: Wir haben auch Gemeinden untersucht, in denen die Ablehnungsquote trotz Urnenabstimmung nicht gestiegen ist. Statistisch gesehen hat sich aber gezeigt, dass diese Form der Einbürgerungspraxis die Quote in die Höhe schnellen lässt.
Herausgefunden haben Sie auch, dass einzig die SVP Einfluss auf die Einbürgerungspraxis nehmen kann: In Gemeinden, in denen die Partei aktiv ist, werden durchschnittlich fünf Prozent mehr Gesuche abgelehnt. Weshalb gelingt es anderen Parteien nicht, bei diesem Thema wirksam zu werden?
Für die SVP sind Ausländer- und Einbürgerungsfragen klar Themen, die sie ins Zentrum ihrer Politik stellt. Für die anderen Parteien gilt dies in weit geringerem Mass – Parteien müssen bei den Themen, die sie bewirtschaften ja Prioritäten setzen. Bei Einbürgerungsthemen strebt lediglich die SVP Meinungsführerschaft an. Dies spiegelt sich auch in den Resultaten unserer Untersuchung.
Ebenfalls festgestellt haben Sie, dass in Gemeinden, in denen ein restriktives Staatsverständnis vorherrscht, die Ablehnungsquote von Einbürgerungsgesuchen bis zu 4 Prozent höher liegt als der Durchschnitt. Was verstehen Sie unter einem solchen Staatsverständnis?
Im Zentrum steht die Frage der nationalen Identität: Welche Vorstellungen haben Menschen vom «Schweizer-sein»? Und welche Bedingungen müssen Einbürgerungskandidaten erfüllen, um diesen Vorstellungen zu genügen. In der Stadt Bern beispielsweise ist man der Meinung, dass Ausländer nach 12 Jahren integriert sind. Nach dieser Zeitspanne muss man keinen Beweis mehr erbringen, dass dem so ist. Die Rahmenbedingungen sind sehr offen.In anderen Gemeinden hingegen müssen Einbürgerungskandidaten Schweizerdeutsch sprechen und über die Geschichte Bescheid wissen. Bei Einbürgerungen fällt also ins Gewicht, ob das vorherrschende Staatsverständnis in einer Gemeinde eher pluralistisch oder ob es sehr eng definiert ist.
Welche Konsequenzen für die Praxis müsste man aufgrund dieser Forschungsresultate ziehen?
Die Resultate unserer Studie bestätigen, was man teilweise schon vermutet hat: Einbürgerungskandidaten sind letztlich von Kommunalpolitikern abhängig. Die Unterschiede, die in der Einbürgerungspraxis der verschiedenen Gemeinden bestehen, sind ziemlich gross, entsprechend gross ist der Spielraum für willkürliche Entscheide.
Letztlich entscheidet der Wohnort darüber, wie einfach oder wie schwierig es ist, die Staatsbürgerschaft zu erlangen. Das ist problematisch. Deshalb sollte man auf nationaler Ebene klare Einbürgerungskriterien für die Gemeinden festlegen, minimale Sprachkenntnisse beispielsweise. Solche Kriterien müssten natürlich zuerst in der Diskussion bestimmt werden, was zugegebenermassen nicht ganz einfach ist.
In Einbürgerungsfragen besteht ein Konflikt zwischen Recht und Politik: Das Bundesgericht hat Einbürgerungsabstimmungen an der Urne als verfassungswidrig erklärt. Die Politik opponiert dagegen. Wie sieht die Zukunft aus?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man wieder zu Urnenabstimmungen zurückkehren wird. Diesen Eindruck haben wir übrigens auch bei Interviews mit Politikern aller Couleur gewonnen, die wir im Rahmen unserer Studie geführt haben. Der Einwand des Bundesgerichts, an Urnen dürfe nicht über das Schicksal von Einzelnen befunden werden, sollte letztlich ein gewichtiges Argument in Einbürgerungsfragen bleiben – wir stimmen schliesslich auch nicht darüber ab, ob jemand eine Parkbusse erhält oder nicht. Wenn auf Gemeindeebene über Einbürgerungen befunden wird, sollte eine Kommission dafür zuständig sein, die nach allgemein anerkannten Kriterien über die Gesuche entscheidet.
Ihr Projekt läuft noch bis Ende 2006. Nach den ersten quantitativen Erhebungen, auf denen die aktuellen Resultate beruhen, haben Sie nun Fallstudien in 14 Gemeinden gemacht. Worum geht es?
Wir wollen in den Fallstudien detailliert nachvollziehen, wie die Entscheidungsprozesse in einzelnen Gemeinden funktionieren. Wenn wir ganz allgemein gesagt haben, die SVP spiele in Einbürgerungsfragen eine entscheidende Rolle, so trifft das natürlich nicht auf alle Gemeinden zu. Solche Differenzen wollen wir nun qualitativ genauer betrachten.
Wir haben deshalb in jeder Gemeinde mit wichtigen politischen Akteuren 10 bis 20 vertiefende Interviews über persönliche Vorstellungen zum Thema Einbürgerung und nationale Identität geführt. Diese Arbeit haben wir im März abgeschlossen und sind nun mit der Auswertung beschäftigt.