Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch
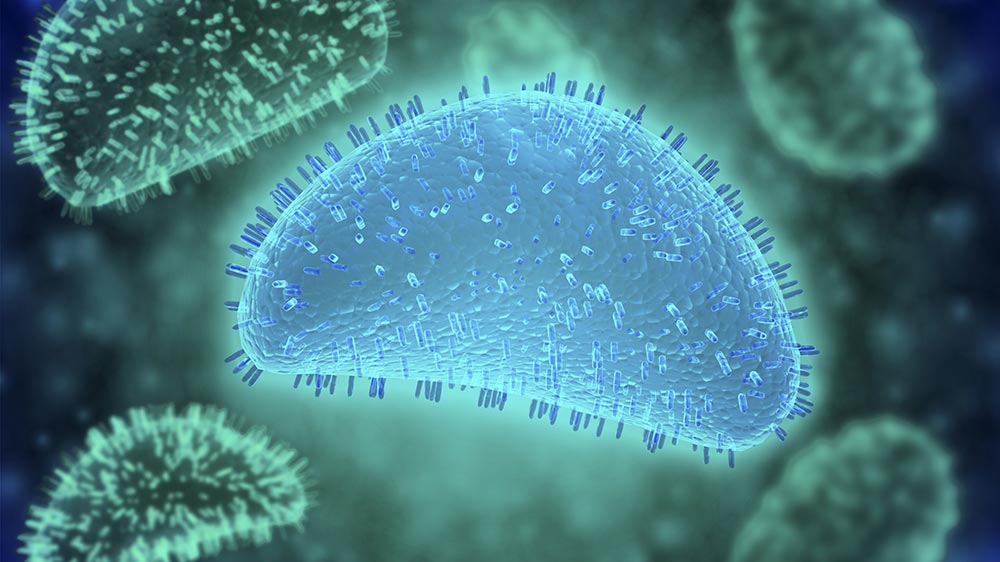
Ein Bazillenforscher macht Experimente – und wundert sich eines Morgens, weil in einer Petrischale über Nacht grosse Flecken entstanden sind, wo nichts mehr wächst. Die Geschichte von Alexander Fleming ist bekannt: Der Bakteriologe hat 1928 das Penicillin entdeckt, ohne danach zu suchen: Schimmelpilze hatten einen sehr wirksamen Stoff produziert, um die Konkurrenz in Schach zu halten. Der Zufallsfund des Antibiotikums hat die Medizin verändert. War er bis dahin vor allem ein Linderer und Symptomerklärer, wurde der moderne Arzt nun endgültig zum Heiler, der mit wirksamen Medikamenten jedem menschlichen Leiden entgegenwirken kann.
Jedem Leiden? Willkommen in der Schnupfensaison. Bakterielle Infekte haben ihren Schrecken im Zuge der Antibiotika-Revolution zwar verloren, doch oft plagen uns nicht Bakterien, sondern viel einfachere Gebilde, die Viren. Und gegen diese fehlen uns auch bald hundert Jahre nach Flemings Fund schlagkräftige Mittel. Auf einen ähnlichen Zufallsfund darf man nicht hoffen, denn Fleming hatte eben nur ge- und nicht erfunden: Er war auf Waffen gestossen, die die Natur schon lange einsetzt. Eine ähnliche Substanzklasse wird gegen Viren wohl nicht so schnell zu finden sein, dafür ist die Funktionsweise der Erreger zu verschieden.
Will man ein Virus ausmanövrieren, muss man gezielt vorgehen, und dafür erst einmal genau verstehen, wie diese Erreger funktionieren. Oder um es im Krimi-Jargon zu sagen: Fleming war der etwas schusselige Kommissar, der beim Kopflüften im Garten über die Tatwaffe stolpert. Dagegen ist die Suche nach einem «Viren-Antibiotikum» eher etwas für Profiler, die mit analytischer Schärfe und mit grossem technischem Verstand an das Problem herangehen. Denn der Fall ist kompliziert. Eine der profiliertesten Spürnasen auf diesem Gebiet hat sein Büro am Irchel Campus der Universität Zürich. Urs Greber leitet eine Forschungsgruppe am Institut für Molekulare Biologie und hat sich auf Vireninfektionen spezialisiert. Im Gespräch mit ihm gerät man allerdings rasch auf Abwege, wenn man über künftige Therapien sprechen will. Denn Viren bekämpfen ist zwar eine klinische, aber auch eine philosophische Herausforderung – da lösen sich allerlei Grenzen auf. «Viren sind Krankmacher, ja», sagt Greber, «aber vor allem sind sie sehr interessant für die Biologie.»
Und diese biologischen Zusammenhänge beginnt man erst jetzt so richtig zu verstehen. Es fragt sich beispielsweise, ob das Zusammenspiel von Viren und Körper eine mehr oder weniger friedliche Koexistenz zum Nutzen beider Seiten ist und nicht ein Kampf zwischen Organismus und Invasor, wie man immer angenommen hat. Tatsächlich sind rund zwei Drittel der Erbinformation in unserem Blut viralen Ursprungs. Dies hat die mikrobiologische Erforschung des sogenannten Viroms ergeben, bei der das genetische Material im Körper, das eigentlich gar nicht zu uns gehört, analysiert wird. Und dieses Material wird wie bei einer Art Gen-Basar rege ausgetauscht. Denn manch eine dieser fremden Gensequenzen ist für uns tatsächlich von grossem Nutzen, und es kann sogar sein, dass sie flugs in unser Erbgut eingebaut wird.
Aber es gibt auch Viren, die uns zu schaffen machen. Die Fast-Lebwesen sind sehr gut darin, sich vor der Immunabwehr zu schützen, indem sie tief ins System eindringen. Das macht es schwierig, sie zu bekämpfen. Besonders gefährlich sind zoonotische Erreger, also solche, die aus dem Tierreich auf uns überspringen. Sie sind nicht an uns angepasst, das erhöht ihre Schlagkraft.
Zwischen einem viralen Angriff und der Immunantwort stellt sich meist ein prekäres Gleichgewicht ein. Doch diese Balance wird leicht gestört, wenn wir müde oder gestresst sind oder das Immunsystem geschwächt ist. «Viren sind erfolgreich durch ihre schiere Masse», sagt Greber. Wenn sie das Immunsystem überlisten können, dann «überdrehen» sie den Metabolismus und die Abwehrkräfte des Körpers regelrecht, um sich in einem grossen Schwall zu vermehren, was zu Fieberschüben führt oder gar den ganzen Organismus akut gefährdet.
Viren sind nicht immer gleich aktiv, sie können sich ruhig verhalten und so fast vom Radar verschwinden. Es kommt aber auch der Moment, an dem sie koordiniert losschlagen. Und genau dies könnte ihr Schwachpunkt sein, glauben die Zürcher Wissenschaftler. Urs Grebers versucht mit seiner Gruppe, die virale List zu überlisten – das hat schon fast homerische Dimensionen. Denn das Virus ist mit einem Trojanischen Pferd vergleichbar, mit dem Geninformation in eine menschliche Zelle hineingeschmuggelt werden soll. Dieses Manöver lässt sich nur schwer aufhalten, unter anderem auch, weil Viren so variabel sind, weil sie sich so schnell anpassen können.
Darin sieht Biologe Greber denn auch den Schwachpunkt aktueller antiviraler Therapien: Um das Virus direkt zu attackieren, müsse man drei oder vier Ziele gleichzeitig angreifen, sonst mutiert es sich auf und davon (siehe Kasten). Greber will das Virus da packen, wo es auf den Körper angewiesen ist: Es brauche nämlich so etwas wie einen Verräter in der Zelle, der ihm signalisiert, wann es Nacht ist. Den Moment des Losschlagens müsse ein Virus sehr genau kontrollieren, sonst nütze ihm die ganze Tarnaktion nichts. Eine alternative therapeutische Strategie könnte also sein, diesen Verräter auszuschalten. Funktioniert der Ansatz tatsächlich, dann würden die Trojanischen Pferde zwar weiterhin unbesehen in die Zelle eindringen, doch da würden die Angreifer dann versauern, sie würden umsonst auf das Signal zum Angriff warten – die eigentliche Infektion, das heisst die feindliche Übernahme der Zellfunktion und die massenhafte Weitervermehrung blieben damit aus. Die Schwierigkeit dabei: Je mehr man bei der Therapie auf den Wirt fokussiert, desto grösser wird die Gefahr von Nebenwirkungen.
Trotzdem gilt das Konzept als derzeit am vielversprechendsten für antivirale Medikamente, manche dieser sogenannten Inhibitoren werden bereits in klinischen Tests erprobt. Der Schlüssel liegt in der Grundlagenforschung, die immer besser versteht, wie Virus und Wirt zusammenleben. Denn erst wenn dieses Miteinander richtig verstanden ist, werden sich Erfolge einstellen.