Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch
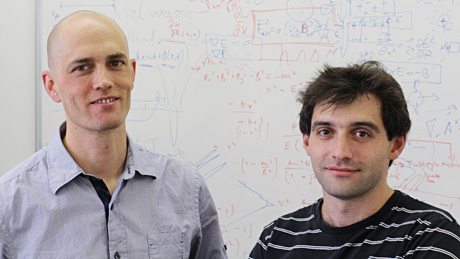
Wenn Wassermoleküle von der flüssigen in die gasförmige Phase verdampfen, wechseln sie ihren Aggregatzustand. Die mathematische Beschreibung eines derartigen Phasenübergangs birgt Tücken in sich, denn für den Wechsel braucht es eine Keimbildung. Die Theorie dahinter, die klassische Keimbildungstheorie (classical nucleation theory CNT), gilt jedoch als sehr ungenau. Frühere Studien liessen vermuten, dass die mit der CNT ermittelte Rate der gebildeten Keime unterschätzt wird.
Das Forscherteam unter Leitung des Physikers Jürg Diemand, Professor an der Universität Zürich, nahm nun den Prozess unter die «Lupe», bei dem sich Flüssigkeit in Dampf verflüchtigt. Dies taten dies mit Hilfe der Supercomputer am nationalen Rechenzentrum CSCS im Tessin.
Es zeigte sich, dass die Theorie teilweise durchaus die Realität widerspiegelt. Die Keimbildungstheorie unterschätzt die Bildungsrate der Gasblasen nur bei sehr tiefen Temperaturen. Mit den Simulationen erhielten die Forscher zudem Einblick in die möglichen Ursachen für die Abweichungen.
Licht ins Dunkel der «Black Box» der Phasenübergänge zu bringen, bei denen eine zuvor stabile Substanz metastabil wird, um sich dann in eine neue stabile Form zu verwandeln, ist für viele Forschungsbereiche relevant. Denn ähnliches geschieht, wenn sich Wolken bilden oder im Kosmos aus Gas Staubteilchen entstehen. Bei diesen Prozessen muss bei der Keimbildung eine kritische Grösse überschritten werden, damit sich ein stabiler Keim der neuen Phase bildet und der Phasenübergang vollzogen wird.
Zwar beschreibe die theoretische Physik mit der Thermodynamik die Gleichgewichtszustände und die makroskopischen Objekte sehr gut, sagt Jürg Diemand. Die zentralen Prozesse bei einem Phasenübergang spielen sich jedoch im viel kleineren Nanometer-Massstab ab. Ein Nanometer ist ein Tausendstel eines Millionstel Meters. Nanopartikel können aufgrund ihrer Kleinheit komplett andere Eigenschaften und Funktionalitäten als ihre makroskopischen Geschwister besitzen.
Die Wissenschaftler um Diemand gingen in ihrer Studie der Frage nach, warum die CNT oft ungenau ist und wie sich die Annahmen im Modell von denen der tatsächlichen Eigenschaften der Gasblasen unterscheiden. Erstmals ist es den Wissenschaftlern in ihrer Studie gelungen, derartig molekulardynamische Prozesse nicht näherungsweise, sondern direkt zu simulieren.
Um dabei die Bedingungen realitätsnah abzubilden, wurde das simulierte Volumen mit einer halben Milliarde Teilchen so gross wie möglich gewählt. «Das geht nur, wenn man eine enorme Rechnerleistung und effizient programmierte Codes zur Verfügung hat, die die Arbeit praktisch ohne Verlust auf viele einzelne Rechenkerne aufteilen können», sagt Diemand. Unter diesen Bedingungen bildeten sich während der Simulation mehrere stabile Gasblasen, ohne dass sich dadurch Temperatur und Druck im simulierten System wesentlich veränderten. Die Forscher konnten zudem die Bildungsrate der Gasblasen bestimmen.
Indem die Forscher ihre Simulationen mit der klassischen Theorie der Keimbildungsrate vergleichen, können sie nicht nur die Theorie überprüfen, sondern auch Schwachstellen aufspüren und darüber letztendlich Verbesserungen einleiten. An der Verbesserung der CNT arbeiten viele Forscher seit Jahren. Für Diemand und sein Team gibt die neue Studie den Hinweis, dass sich die Oberflächenspannung der winzigen jungen Gasblasen ganz anders verhält als die der makroskopischen Blasen.
Mit den Simulationen kommen die Forscher der Realität der Phasenübergänge näher als Beobachtungen oder Experimente. Mit dem «Computerexperiment» und den Visualisierungen des Berechneten gelingt es, die rasend schnell ablaufenden Prozesse zu verfolgen und zu studieren. Überaschenderweise zeigt die bildliche Darstellung der Simulationen der Gruppe von Diemand auch, dass die gebildeten Blasen nicht wie gemeinhin angenommen scharf begrenzt und perfekt gerundet sind. Auch zeige sich beim Phasenübergang von flüssig nach gasförmig keine scharfe Trennlinie, sondern eher ein breites «Band», hält Diemand fest.
Diemand und sein Team erforschen derzeit das Verhalten metastabiler Flüssigkeiten, die als Detektoren zum Nachweis Dunkler Materie eingesetzt werden. Dunkle Materie wurde anhand astronomischer Beobachtungen postuliert und ist im Universum eine allgegenwärtige Masse unbekannter Zusammensetzung. Nach heutiger Schätzung macht sie 85 Prozent der Materie des Universums aus. Über ein spezielles Verfahren soll es möglich sein, Dunkle Materie nachzuweisen, sobald sie auf einen Atomkern einer in einem Detektor eingeschlossenen metastabilen Flüssigkeit trifft. Durch den Zusammenprall sollte eine mit Messgeräten registrierbare Gasblase entstehen.
Ähnliche Detektoren, sogenannte Blasenkammern, sind in den 1960er und 1970er Jahren am CERN und anderen Teilchenbeschleunigern erfolgreich eingesetzt worden. Momentan erlebt die Methode ein Comeback bei der Suche nach der Dunklen Materie. Das theoretische Modell zur Berechnung des Phasenübergangs in den Detektoren stammt noch aus den 60er Jahren und basiert auf der CNT, es ist jedoch noch nie mit Simulationen getestet worden. Man wisse folglich nicht, wie gut es die Realität beschreibt und was wirklich mikroskopisch passiert, sagt Diemand.
Er und sein Team möchten dies nun mit Hilfe neuer Simulationen klären – in Zusammenarbeit mit Forschern des europäischen SIMPLE Experiments (Superheated Instrument for Massive ParticLe Experiments), das nach Beweisen für die Existenz Dunkler Materie sucht.