Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch
Das Schicksal meint es nicht gut mit Patienten, die am Bardet-Biedl-Syndrom (BBS) leiden. Oft sind sie mit einer Kombination von Symptomen konfrontiert, die unter anderem Blindheit, Nierendefekte, Extrafinger oder Extrazehen, Fettleibigkeit oder geistige Behinderung einschliessen können. Das BBS ist eine Erbkrankheit und bisher gibt es keine Therapie.
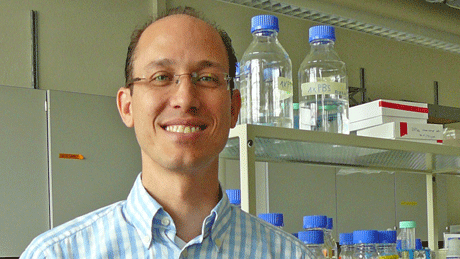
Erbkrankheiten sind eine schwere Belastung für Patienten und Angehörige. Das Institut für Medizinische Molekulargenetik der Universität Zürich unter der Direktion von Wolfgang Berger erhielt vom Bundesamt für Gesundheit die Bewilligung, bei bestimmten Erbkrankheiten genetische Untersuchungen durchzuführen. Die UZH- Forscher geben sich aber nicht allein mit der Diagnosestellung zufrieden, sie versuchen die Krankheitsursachen auf molekularer Ebene zu verstehen, mit dem Ziel neue Therapien zu entwickeln.
John Neidhardt ist Gruppenleiter am Institut für Medizinische Molekulargenetik. Er beschäftigt sich schwerpunktmässig mit Therapieforschung. Um eine neue Therapie entwickeln zu können, muss jedoch zuerst die genetische Ursache einer Krankheit, die sogenannte Mutation, ermittelt werden. Häufig beginnt die komplizierte Suche mit der klinischen Diagnose und dem Studium des Stammbaums betroffener Familien. Daraus lässt sich dann eine Strategie ableiten, um die Mutation zu finden.
In ihrer jüngsten Studie, veröffentlicht im Fachjournal «Human Mutation», untersuchten die Wissenschaftler eine Grossfamilie, die an dem BBS leidet, allerdings in einer milden Form. «Ausser der krankheitstypischen Blindheit liegen bei dieser Familie keine weiteren Symptome vor», erzählt John Neidhardt. Das einzige klare Symptom ist die Augenkrankheit Retinitis pigmentosa, die zu einem Tunnelblick und später meist zur vollständigen Erblindung führt.
Zehn Mitglieder der untersuchten Grossfamilie gaben eine Blutprobe ab, drei davon waren vom BBS betroffen. Im Labor extrahierten die Forscher das genetische Material aus dem Blut. Mithilfe verschiedener genetischer Techniken fanden sie schliesslich die Mutation, welche die Krankheit ausgelöst hatte in einem BBS-Gen. Dieser Gendefekt führte zu einem Fehler in der Maschinerie, die aus dem BBS-Gen ein BBS-Protein macht. Die Folgen: Das Protein ist zu kurz und funktioniert deshalb nicht.
Neidhardts Ziel ist es, in diese Abläufe einzugreifen. Bereits haben er und sein Team einen neuen gentherapeutischen Ansatz erfolgreich getestet. Bei der klassischen Gentherapie würde das gesunde BBS-Gen in einen harmlosen Virus eingeschleust und das kranke Auge mit dem Virus infiziert. Im Auge würde dann ein künstliches BBS-Protein hergestellt. «Wir verfolgen einen anderen Ansatz», sagt Molekularbiologe Neidhardt. «Wir ersetzen nicht das defekte Gen, sondern wir greifen in den Mechanismus ein, der aus dem Gen ein Protein macht». Noch nie zuvor wurde dieser Ansatz bei einer Augenkrankheit gewählt.
Die UZH-Forscher züchteten aus einer stecknadelkopfgrossen Hautspende von Patienten Zellkulturen. «Selbstverständlich können wir nicht mit einem Gewebestück aus dem Auge der Patienten arbeiten», erklärt Neidhardt die Wahl des Studiengewebes. Glücklicherweise sei der Prozess vom Gen zum Protein aber in allen Zellen des Körpers sehr ähnlich.
So kann der Zürcher Therapieansatz gegen die vererbten Augenerkrankungen prinzipiell auch mit Hautzellen getestet werden. Die Forscher infizierten dazu die Zellkultur mit einem Virus, das ein Gen in sich trägt, welches auf dem Weg vom Gen zum Protein eine entscheidende Rolle spielt. Und die Reparatur in der Zellkultur hat funktioniert.
Die Forscher wandten die Therapie aber auch auf andere Gendefekte an – ebenfalls mit Erfolg. Neidhardt: «Wir sind überzeugt, dass dieser Therapieansatz auf viele vererbte Krankheiten anwendbar ist.»
In einem nächsten Schritt wird die Gentherapie am Tiermodel überprüft. Erst dann kann sie bei Patienten angewandt werden. John Neidhardt ist optimistisch: «Das Auge birgt ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Gentherapie. Entscheidend dabei: Das Auge ist ein in sich geschlossenes System. Die Nebenwirkungen sind daher meist gering.»