Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch
Frau Frizzoni, Serien galten lange als zweitklassig. In den letzten Jahren haben sie sich jedoch vom Medientrash zur Kunstform gemausert. Wie kam es dazu ?
Schon seit längerem findet eine Verschiebung in der Beurteilung von Populärkultur statt. Pointiert fasst das ein Buchtitel zusammen: «Everything bad is good for you». Auf der anderen Seite sind die Serien anspruchsvoller geworden. Erzählt werden in der Regel komplexe Geschichten mit einem facettenreichen Figurenensemble, wie es zum Beispiel in der Mafia-Serie «Sopranos» der Fall ist. Haben solche Serien Erfolg, inspirieren sie wiederum Drehbuchautoren neuer Serien.
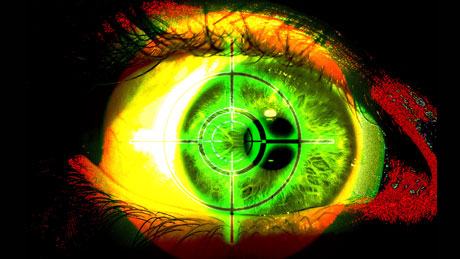
Entwickelt der Zuschauer von Serien auf Dauer ein persönliches Verhältnis zu den Protagonisten?
Ja, von Serienhelden wird im Alltag gesprochen. Häufig schaut man Serien mit Freunden an. Besonders gelungene Dialoge halten sogar Einzug in die Alltagssprache: «Hol schon mal den Wagen, Harry» oder «Beam me up, Scotty». Manche trauern, wenn Serienhelden sterben. In der Medienpsychologie spricht man von parasozialen Beziehungen. Natürlich ist den Zuschauern der fiktive Gehalt des Gesehenen bewusst, und doch sind die Serienhelden für manche prägend. Denken Sie an das Public Viewing der Serie «Sex and the City», bei dem viele Frauen mit ihren Freundinnen zuschauten und sich dabei – ganz im Stil der Serie – einen Manhattan-Drink genehmigten.
Serienheldinnen oder -helden haben Tics und Schwächen. So ist zum Beispiel Ruhrpott-Kommissar Schimansk abseits seines kriminalistischen Geschicks ein veritabler Therapiefall.
Gerade das Schräge und Unkonventionelle gefällt den Zuschauern. Der trockene, stets korrekte Derrick hätte als Serienheld von heute wohl kaum noch Erfolg. Dafür aber Helden, die die Normen strapazieren oder nicht dem Ideal entsprechen. Das ist zum Beispiel auch bei der Krimiserie «Bella Block» der Fall. Die Ermittlerin ist weder jung noch dynamisch, dafür kratzbürstig und intelligent.
Hat das Vertraute und Wiederholende einer Serie auch eine beruhigende Wirkung auf den ansonsten zappenden Zuschauer?
Serien schauen ist für viele ein rituelles Vergnügen. Sonntag Abend ist «Tatort»-Zeit. So strukturiert die Serie den Alltag. Das Setting ist gesetzt, der Zuschauer weiss, was ihn erwartet. Das hat etwas Beruhigendes. Gleichzeitig dürfen Serien nicht einfach wiederholen, immer muss auch etwas Neues, Unerwartetes passieren.
Inwieweit sind die Schauplätze der Serien wichtig? Beim «Tatort» zum Beispiel weiss der Zuschauer, dass in Köln Klaus Behrendt und Freddy Schenk ermitteln.
Beim «Tatort» fasziniert wahrscheinlich eher das Gesamtkonzept, das aus den verschiedenen Figurenensembles – den Kommissaren – und den Orten besteht. Schauplätze können in Serien zwar auch eine grosse Faszination ausüben, aber eher, wenn man diese Plätze nicht kennt und quasi durch die Serie miterleben darf. So etwa in «The Wire», wo Polizisten im Drogenmilieu in Baltimore ermitteln und uns Einblick in Orte gewähren, die wir sonst nie gesehen hätten.
Es gibt jedoch viele Serien, die ziemlich blöd und langweilig sind. Dialoge wiederholen sich ständig. So etwa: «Ihre Frau ist erschossen worden.» «Erschossen!» «Ja, erschossen.» Was macht die gute Krimiserie aus?
Eine Serie sollte gut recherchiert und glaubwürdig sein. Sprachlich zeichnen sich diese Serien durch eine präzise Milieusprache aus. Wenn die Figuren dann noch kauzig und vielseitig sind, wird es spannender. Auch innovative Elemente wie Special Effects oder eine ungewöhnliche oder experimentelle Bildsprache machen die Geschichten attraktiv .
Mit welcher Serie sind Sie sozialisiert worden?
Ich bin ein Kind der 60er Jahre. Geliebt habe ich «Raumschiff Enterprise» und «Graf Yoster gibt sich die Ehre».
Welche Krimiserie ist Ihr Favorit?
Immer Zeit nehme ich mir für den «Tatort», der in Münster spielt. Ich finde die Dialoge und die Figuren lustig: Der eingebildete Rechtsmediziner mit seiner schlagfertigen kleinwüchsigen Assistentin und der Unterschichtskommissar mit dem kiffenden Vater sind ein herrliches Team. Allerdings würde ich diese Serie nicht jede Woche schauen wollen. Aber alle drei Monate einmal freue ich mich darauf.