Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch
Seit 30 Jahren gibt es die Sexualmedizinische Sprechstunde am Universitätsspital Zürich. Hat sich das Konzept, das auf einem interdisziplinären Behandlungsangebot besteht, bewährt?
Sexuelle Störungen haben körperliche und psychische Ursachen. Daher hat sich die Zusammenarbeit der Abteilung Psychosoziale Medizin mit der Frauenklinik und der Klinik für Urologie bewährt und wird von allen Seiten sehr geschätzt. Nach wie vor haben wir eine Wartefrist für neu angemeldete Patientinnen und Patienten, die nicht selten drei bis vier Monate beträgt, was für die Patienten wie auch für die zuweisenden Ärzte nicht ideal ist.
Wenn die Nachfrage so gross ist, weshalb stehen dann nicht mehr Stellenprozente für die Spezialsprechstunde zur Verfügung?
Das liegt zum einen an der Stellensituation, aber auch am Stellenwert, den man dem Thema Sexualität in der Medizin und der Wissenschaft zumisst. Leider wird nicht in die Sexualsprechstunde investiert, obwohl das Angebot gefragt ist und es in dieser Form einmalig ist in der Schweiz.
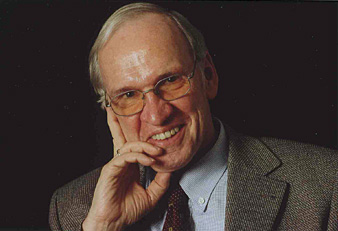
Haben Sie sich aufgrund der knappen Ressourcen für die sexualmedizinische Weiterbildung der Haus- und Frauenärzte eingesetzt?
Hausärzte und Hausärztinnen schätzten noch 1980 ihre sexualmedizinischen Kenntnisse als relativ gering ein. Doch ca. sechs Prozent aller Patientinnen und Patienten suchen ihren Arzt oder ihre Ärztin u.a. wegen sexueller Störungen auf. Es bestand also Handlungsbedarf. Heute sprechen mehr Ärzte ihre Patienten auf sexuelle Probleme an als Anfang der 80er-Jahre, und sie fühlen sich auch in der Beratung sexualmedizinischer Probleme kompetenter. Ich habe mich schon früh dafür eingesetzt, sexualmedizinische Vorlesungen und Kurse als festen Bestandteil im Medizinstudium und in der ärztlichen Fortbildung zu verankern. Wichtig und notwendig ist dabei, dass nicht nur sexuelle Störungen thematisiert werden, sondern beispielsweise auch sexuelle Übergriffe zwischen Arzt und Patient oder die Sexualität von Jugendlichen. Die Wissenschaft sollte sexuelle Themen nicht reisserischen Medien überlassen, die nur darauf aus sind, Klischees zu verstärken und falsche Bilder über Sexualität zu vermitteln.
Sie haben anhand von Fragebogen aus der sexualmedizinischen Sprechstunde nachgewiesen, dass im Jahr 2004 die häufigsten Probleme Erektionsstörungen bei Männern waren, während 1980 die Orgasmusschwierigkeiten bei Frauen an erster Stelle standen. Wie kommt es zu dieser Veränderung?
Erektionsstörungen lassen sich heute besser abklären und behandeln als noch vor zwanzig Jahren. Ausserdem nehmen Erektionsstörungen mit dem Alter zu. Da jedoch eine erfüllte Sexualität im Alter für viele Menschen immer wichtiger wird, wird das Thema auch vermehrt angesprochen. Allerdings wundere ich mich darüber, dass nicht noch mehr Männer das Problem angehen, denn es ist eine häufige Störung. Erektionsstörungen sind nach wie vor ein Tabuthema. Wir wissen aus Untersuchungen, dass Patienten erwarten, dass ihr Arzt die Initiative ergreift und das Problem anspricht.
Orgasmusschwierigkeiten bei Frauen sind aufgrund der sexuellen Emanzipation zurückgegangen. Das ist sicherlich auch ein Verdienst der Frauenbewegung. Das häufigste Problem mit dem wir jedoch jetzt konfrontiert sind, ist sowohl für Männer als auch Frauen die Libidostörung, also mangelnde sexuelle Lust . In der sexualmedizinischen Sprechstunde kam es zu einem deutlichen Anstieg dieser Diagnose bei weiblichen Patientinnen: Von 30% im Jahr 1980 bis auf fast 50% im Jahr 1990. Der Anteil der Männer mit Libidostörungen lag im Jahr 1994 bei 10 Prozent, nimmt jedoch ebenfalls zu.
Wie viel sexuelles Begehren ist denn normal?
Sexueller Leistungsdruck, Ängste zu versagen und nicht genug intensiv und schnell zu reagieren, führen zu Stress und zur Flucht aus der Sexualität. Häufig haben Männer und Frauen fixe Vorstellungen davon, wie Sex sein muss. Sie sehen nicht, dass sexuelle Bedürfnisse sich nicht linear entwickeln, sondern dass sie sich im Laufe des Lebens wandeln. So kann eine Geburt beispielsweise die sexuelle Appetenz verändern. Auch Stress zeigt nicht nur endokrinologische, also organische Wirkung, sondern drängt zudem das sexuelle Verlangen in den Hintergrund.
Viele Leute stehen heute unter dem steten Druck, die Besten im Beruf zu sein, zu Hause alles zu meistern und sexuell auf dem Höhepunkt zu bleiben. Dabei merken sie nicht, wie sie sich verlieren und ihr Sexualleben inszenieren anstatt es zu leben.
Wenn Sie zurückblicken, hat sich dann Ihr eigener Zugang zur Problematik gewandelt?
Die Art, wie ich mit den Patientinnen und Patienten über ihre Sexualität spreche, hat sich geändert. Zu Beginn habe ich mich auf den medizinischen Aspekt der Sexualstörung konzentriert. Heute betrachte ich meine Patienten umfassender. Ich berücksichtige ihre Biographie, beziehe Erfahrungen aus der Kindheit mit ein und beachte ihr Partnerschaftsverhalten. Dadurch wird die Arbeit allerdings auch komplexer.