Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch
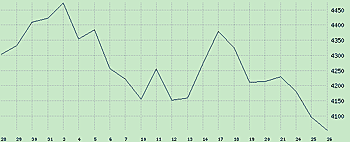
Mit Wehmut erinnert man sich an die letzte IT-Blase. Drei Jahre erst ist es her, dass sie geplatzt ist. Seither herrscht Traurigkeit an der Börse; die «Bären» (die Pessimisten) haben das Sagen. Thorsten Hens, Professor am Institut für Empirische Wirtschaftsforschung der Universität Zürich, beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit den «Bubbles», den euphorischen Aufblähungen der Aktienkurse. Diese lassen sich mit den klassischen Theorien der Rationalität der Finanzmärkte nicht erklären. Wenn sich das Spekulationsfieber an Tulpenzwiebeln, Eisenbahnen oder eben am Internet entzündet, treten vernünftige Anlageüberlegungen ausser Kraft. Die irrationalen und unbewussten Kräfte der Psychologie nehmen Überhand, die Investorinnen und Investoren setzen auf Aktien wie Think Tools, die das Blaue vom Himmel herunter versprechen und wenig realen Mehrwert generieren. Die Börsenwelt steht Kopf.
Was hätte man tun müssen, damit die IT-Blase nicht jäh - wie geschehen - platzt, sondern sanft landen würde? Das ist die zentrale Fragestellung von Prof. Thorsten Hens. Hens' Forschungsprojekt ist Teil des Nationalen Forschungsschwerpunkts FINRISK, an dem verschiedene Schweizer Universitäten zu unterschiedlichen Aspekten von Risikomanagement an Finanzmärkten (Versicherungen, Banken) forschen. Verschiedene Vermutungen, wie das Platzen der Internetblase hätte verhindert werden können, wurden seit dem «schwarzen Frühling» 2000 laut, als es mit der Börse in heftigen Schüben abwärts ging. Zum Beispiel: Der amerikanische Notenbankchef Alan Greenspan hätte die Zinsen für Festgeld früher und noch stärker erhöhen sollen, als er dies getan hat, um den überhitzten Aktienhandel abzukühlen.
Nein, hat Thorsten Hens in Experimenten herausgefunden: Höhere Zinsen hätten nichts gebracht. So hoch wie die erwarteten Aktiengewinne hätten die Zinsen gar nicht sein können. Selbst bei völlig unrealistischen Zinssätzen von dreissig Prozent waren die Gewinnerwartungen während des Booms bei den IT-Aktien noch immer um einiges höher. Hohe Zinsen hätten als unschönen Nebeneffekt auch hohe Mietzinsen und andere marktwirtschaftliche Fallstricke zur Folge gehabt. Die Spekulationslust hätte nur gemildert werden können, indem die Liquidität verringert worden wäre. Wenn weniger Geld zum Investieren zur Verfügung gestanden hätte, hätte weniger spekuliert werden können, lautet die einfache Überlegung.
Diese Erkenntnisse hat Thorsten Hens anhand von Experimenten mit Studierenden gewonnen. 40 mal wurden 24 Versuchspersonen eingeladen, im «Labor» des Instituts für empirische Wirtschaftsforschung mit «Wertpapieren» zu handeln bzw. Geld in «Festanlagen» zu investieren. 15 Runden wurden durchgespielt, nach jeder Runde wurde den «Aktionären» nach dem Zufallsprinzip (Würfeln) eine Dividende zwischen 0 und 60 Einheiten ausgeschüttet. Alternativ zu den «Aktien» konnten die Mitspielenden ihr Geld auch als Festgeld mit Zins anlegen. Je nach Lage auf dem «Aktienmarkt» wurden Zinsen von 5 bis 21 Prozent gegeben. Vor jeder Runde des Aktienhandels mussten die Studierenden entscheiden, wie viel Geld sie in dieser Runde auf dem Festgeldkonto anlegen. Das in einer Runde auf dem Festgeldkonto angelegte Geld konnte in dieser Runde nicht für Aktienhandel verwendet werden. Nach 15 Runden war das Spiel, wie gesagt, beendet und die Spielenden durften das erwirtschaftete Geld mit nach Hause nehmen. Es war allen Studierenden bekannt, dass die Aktien am Ende der 15 Perioden wertlos sein würden. Es stellte sich heraus, dass hohe Festgeldzinsen den überhitzten Aktienhandel nur wenig dämpften; die Spielenden waren mehrheitlich selbst bei enorm hohen Zinssätzen von 21 Prozent nicht bereit, auf die überzahlten, aber mehr Spekulationsgewinn versprechenden Aktien zu verzichten. Die börsenpsychologische Erklärung: Wenn jemand mal vierzig oder mehr Prozent Gewinn mit Aktien gemacht hat, bleiben seine Erwartungen die nächsten Male hoch. Solche Gewinne sind Öl ins Feuer der Spekulationslust.
Nur eines stoppt das weitere Aufblähen der spekulativen Blasen: wiederholt schlechte Erfahrungen. Auch in Boomphasen gibt es ja immer auch Verlierer, und diese sind nicht bereit, mehrmals hintereinander überzahlte Aktien zu kaufen. Sie steigen aus dem Aktienmarkt aus, wie das seit drei Jahren an der realen Börse zu beobachten ist, und so schnell verlockt sie das schnelle Geld an der Börse nicht mehr. «Für die nächste Blase braucht es wahrscheinlich eine neue Generation, die sich nicht mehr an den geplatzten Bubble erinnert und mit frischem Elan wieder an die Börse glaubt», vermutet Thorsten Hens. Ein paar Jahrzehnte dürfte das schon dauern.
Zur Zeit befinden wir uns an der realen Börse im «sekulären Bärenmarkt», d.h. die Kurse gehen in Zyklen nach unten. Professor Hens überlegt sich auch, wie man sich unter solchen schlechten Umständen als Anleger verhalten sollte. «Die buy and hold strategy geht gegenwärtig einfach mit dem Trend nach unten», erklärt der Ökonome, «besser, man verhält sich kontrazyklisch: Wenn es ein Zwischenhoch gibt, muss man möglichst viele Aktien verkaufen; wenn es wieder einen Kurseinbruch gibt, zukaufen.» Man nennt dieses Verhalten «volatility pumping», Hens bezeichnet es auch als «Tanz mit den Bären». Grossanleger wie Versicherungen und Pensionskassen täten gut daran, von ihrer Buy-and-hold-Strategie Abstand zu nehmen und die Milliarden aktiver zu bewirtschaften, dann könnten sie selbst in der momentanen Krise sechs bis sieben Prozent Gewinn herausholen, ist Hens überzeugt.
Letztlich soll Hens' Forschung zeigen, ob es in Finanzmärkten einen Mix von Anlagestrategien gibt, die gegenseitig voneinander profitieren und zu einem stabile(re)n System führen. Zwar kann die Börse als strikt kompetitiv angesehen werden, aber vielleicht gibt es in diesem darwinistischen Kampf um den höchsten Gewinn und damit ums (finanzielle) Überleben ja Verhaltenskombinationen, die extreme Börsenhochs (Bubbles) oder -tiefs (Crashs) vermeiden helfen. Denn solch masslose Entwicklungen der Kurse sind schädlich für das Gemeinwohl, da die Finanzströme in unproduktive Bereiche abfliessen (zum Beispiel in AGs, die den Erwartungen gar nicht gerecht werden können, wie während des IT-Bubble).
Langfristig sind «gesunde» Investitionen - Hens nennt vor allem das Investieren in Bildung und technologische Entwicklung - für die europäischen Länder überlebenswichtig. Denn nach wie vor ist das «Humankapital» in rohstoffarmen Hochpreisländern wie der Schweiz deren grösste Stärke.