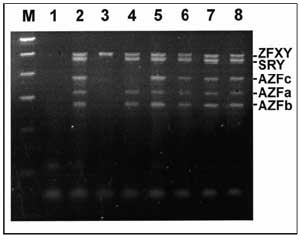Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch

Anhand einer einfachen Speichel-, Haar- oder Blutprobe kann man den Gensatz eines Menschen analysieren. So funktioniert zum Beispiel der Vaterschaftstest. Das Genom verrät aber auch, ob jemand für bestimmte Erbkrankheiten anfällig ist. Dieses Wissen kann für die Betroffenen wertvoll sein, um dem Ausbruch der Krankheit vorzubeugen. Doch es ist auch für Personalchefs interessant, wenn sie Bewerbungen beurteilen müssen: Sie können durch eine geschickte Anstellungspolitik krankheitsbedingte Ausfälle vermeiden und so Kosten senken. Das darf doch nicht sein, finden viele. In der Schweiz ist denn auch ein Gesetzesentwurf in Vernehmlassung, der die Anwendung von Genomanalysen im Personalbereich verbieten soll.
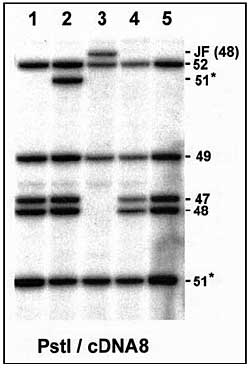
Die Betriebswirtschafterin Ingrid Eckerstorfer untersucht Chancen und Risiken der Anwendung von Gentests bei der Personalrekrutierung. Sie ist sich bewusst: «Das ist ein schwieriges Thema, das viel Fingerspitzengefühl verlangt.» Die Privatsphäre steht auf dem Spiel, und Menschen mit vererbten Krankheitsrisiken könnten diskriminiert werden. Gerade deshalb, so Eckerstorfer, sei es an der Zeit, dass das heikle Thema ans Licht geholt und offen diskutiert werde. Es sei nämlich auch schon vorgekommen, dass eineFirma Gentests ohne das Wissen der Mitarbeiter durchführen liess.
Ingrid Eckerstorfer arbeitet am Lehrstuhl für Human Resource Management im Team von Professor Bruno Staffelbach. Schon in ihrer Diplomarbeit hat sie die Bedeutung genetischer Veranlagungen für die Personalrekrutierung von Unternehmen untersucht. Sie hat die Personalchefs eines grossen Schweizer Detailhandelsunternehmens befragt, wie sie zu Genomanalysen stehen - sie lehnten deren Einsatz einhellig ab.
Diese Fallstudie soll jetzt ausgebaut werden. In ihrer Doktorarbeit, die vom Forschungskredit der Universität Zürich unterstützt wird, möchte Ingrid Eckerstorfer Vor- und Nachteile von Gentests in Unternehmen aufzeigen - nicht nur ökonomische, sondern auch moralische und soziale. Wie diese zu beschreiben und zu gewichten sind, ist allerdings eine interdisziplinäre Knacknuss: Hier sind auch soziologische, medizinische, ethische und juristische Ansätze gefragt.
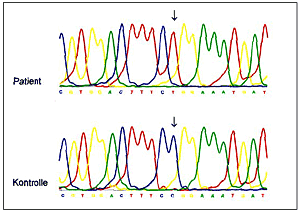
Um die Akzeptanz von Gentests im Personalbereich zu testen, will Ingrid Eckerstorfer Manager und Arbeitnehmer in Schweizer Firmen befragen. Daneben erwägt sie aber auch experimentelle Szenen, die mitTestpersonen durchgespielt würden: Ändert jemand seine Einstellung zu Gentests, wenn er oder sie mit einem belastenden Befund konfrontiert wird?
So möchte die Betriebswirtschafterin ein Entscheidungsmodell entwickeln, das den Verantwortlichen in einem Unternehmen helfen kann, sich über Sinn und Unsinn von Gentests Klarheit zu verschaffen. Besonders wichtig ist dabei, dass die Interessen aller Beteiligter zum Zug kommen. Ein solches Modell darf man aber nicht als simples Patentrezept verstehen. Eckerstorfer betont: «Es gibt hier keine einfachen Antworten.»
Was hat die gebürtige Linzerin von der Donau an die Limmat gelockt? «Mein Herz schlägt schon für Österreich», bekennt sie. Aber aus einem Zürcher Gastsemester während ihres Wirtschaftsstudiums hat sich das Thema ihrer Diplomarbeit ergeben, und dann hat sich Ingrid Eckerstorfer entschieden, auch ihre Dissertation in Zürich zu schreiben. Sie konnte davon profitieren, dass das Thema Genomanalyse bereis in einer Arbeitsgruppe von z-link entwickelt wurde. z-link hat dann auch die Startphase des Dissertationsprojekts mit Drittmitteln unterstützt. Daneben profitiert Ingrid Eckerstorfer von einer engen Zusammenarbeit mit Forscerinnen der Universität Bern sowie mit Firmen aus Deutschland und der Schweiz.
Ein Beitrag aus dem Forschungskredit der Universität Zürich macht es möglich, dass sich Ingrid Eckerstorfer in den nächsten anderthalb Jahren ganz ihrem Projekt widmen kann. Auf den Forschungskredit ist sie bei der Internet-Suche nach Geldquellen gestossen. Sie schätzt ihn als «sinnvolles und interessantes Programm», das eine Lücke schliesst. Nationale und internationale Programme fördern nämlich vor allem grosse Projekte, die lange dauern. Dissertationen fallen da oft unter den Tisch. «Man braucht schon langjährige Erfahrung, bis man überhaupt einen Projektantrag stellen darf», meint Eckerstorfer. Nicht so beim Forschungskredit: «Hier kann man auch als Jungforscherin in einer wichtigen Phase der akademischen Laufbahn ein Projekt selber einreichen.