Navigation auf uzh.ch
Navigation auf uzh.ch

Tristan Weddigen, Professor für Kunstgeschichte der Neuzeit, schreibt über den Grenzgänger Heinrich Wölfflin: Als berühmtester Kunsthistoriker seiner Zeit wurde Heinrich Wölfflin (1864–1945) 1924 als Ordinarius ad personam an die Universität Zürich berufen. Die Rückkehr in die neutrale Heimat dürfte dem politikfernen, seit 1914 in München lehrenden Professor angesichts von Ruhr-Besetzung, Hyperinflation und Hitler-Putsch leicht gefallen sein.

Wölfflin, der im Kaiserreich aufgewachsen und bei Jakob Burckhardt in Basel studiert hatte, 1893 dessen Nachfolger und 1901 nach Berlin berufen wurde, war ein intellektueller Grenzgänger, der die ästhetischen Identitäten der europäischen Kulturen selbst zum Thema machte. Eines der erfolgreichsten Bücher unseres Faches, die «Kunstgeschichtlichen Grundbegriffe» von 1915, stellte dem Positivismus und der Künstlerbiografie ein neues, aus Einfühlung geschöpftes System deskriptiver und charakterisierender Form- und Stilbegriffe entgegen, das der Kunstwissenschaft als einer «Geschichte des Auges», wie er in seiner Zürcher Antrittsvorlesung sagte, einen autonomen Status gegenüber der Geschichtswissenschaft verschaffen sollte.
Der Publikumserfolg Wölfflins lag in seinen Vorlesungen, in denen er mittels Doppelprojektion das vergleichende Sehen anschaulich machte. Wölfflin, dessen «Charakterkopf» heute die Aula ziert, gehört zu den radikalen Erneuerern der Geisteswissenschaften. Sein Erbe ist heute so selbstverständlich, dass es wieder der Erforschung bedarf.
Peter Truöl, Emeritierter Professor für Physik, schreibt über die erste Rektorin der Universität Zürich: Ausgerechnet aus der Physik, einem Studiengang mit minimalem Frauenanteil, stammte die erste und bisher einzige Rektorin der Universität Zürich – ist dies ein Zufall? Verena Meyers Forschung in der Experimentalphysik zeichnete sich aus durch sorgfältige Analyse, Planung und Konstruktion eines passenden Experiments, das oft eine mutige technische Weiterentwicklung erforderte, und schliesslich eine kritische Betrachtung der Messdaten. Mit dieser Methodik war sie auch gut gerüstet für ihre administrativen Aufgaben an der Hochschule und für ihre spätere einflussreiche Tätigkeit in der Schweizer und der internationalen Wissenschaftspolitik.

Bescheiden und frei von persönlicher Eitelkeit stellte sie sich in den Dienst der Sache, und beeinflusste ihr Umfeld dank konzentrierter Arbeit und natürlicher Autorität. Sie beeindruckte uns schon als Studierende, wenn sie uns einfühlsam und geduldig in Vorlesung und Praktikum sowie später im Labor, als Doktormutter, zur Seite stand. Die mächtigen experimentellen Einrichtungen, mit denen die Teilchenphysik heute Prozesse im frühen Universum nachvollziehen will, wären undenkbar ohne die Vorarbeit an dem kleinen Beschleuniger, den Verena Meyer am Physik-Institut in den Fünfzigerjahren mitbaute.
Von 1948, als sie sich immatrikulierte, bis heute erstreckt sich ihr Wirken an der UZH. Uns bleibt insbesondere ihre Rede zum Universitäts-Jubiläum 1983 in Erinnerung. Die Wissenschaftspolitik trieb sie auch nach ihrer Emeritierung 1994 noch um, so gehörte sie dem Expertenrat an, der 2000 alle Universitäten in Nordrhein-Westfalen evaluierte. «Kreatives Alter» nennt sich eine der vielen Stiftungen, für die sie als Expertin tätig ist, ein Motto, dem sie in ihrem neunten Lebensjahrzehnt wahrlich nachlebt.
Thomas F. Lüscher, Professor für Kardiologie , schreibt über den Mediziner Anke Senning: Entscheidend für die Karriere des gebürtigen Schweden Ake Senning (1915–2000) war die Begegnung mit Clarence Crafoord, der ihn in die Herzchirurgie einführte und ihn anwies, eine Herz-Lungen-Maschine zu entwickeln, was rasch gelang.

1958 implantierte er bei einem Patienten mit AV-Block den ersten permanenten Schrittmacher und schrieb mit dem Elektroingenieur Rune Elmqvist Geschichte. Dennoch verzichtete er auf ein Patent: «Medizinische Entdeckungen gehören der Medizin und nicht dem Erfinder.» Lange vor der ersten Bypass-Operation führte Senning nach der Strip-Graft-Technik die erste Endarterektomie der Koronararterien und verschloss 1959 einen Vorhofseptumdefekt.
Senning wurde 1961 an die UZH berufen. 1964 gelang ihm die erste Nieren- und 1968 die erste Herztransplantation der Schweiz. Ein letzter Geniestreich folgte 1981 mit einer neuen Korrektur des Budd-Chiari-Syndroms, bei der er die Einengung der Lebervenen durch eine direkte Anastomose an das rechte Herz umging. Senning war Mitglied zahlloser medizinischer Gesellschaften, erhielt viele Ehrungen und trat mit über 350 Publikationen hervor. Er machte Zürich zu einem weltweit anerkannten Zentrum der Herzchirurgie und in der Folge der Kardiologie.
Sabine Schneider, Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, schreibt über den Germanisten Emil Staiger: Das Auratische seiner berühmten 11-Uhr-Vorlesungen in der Aula wirkte über die Grenzen der Universität und die des Landes hinaus. Die Hingabe für den Gegenstand, die Emil Staiger (1908–1987) von jedem Germanisten forderte, verkörperte er selbst durch ein Charisma, das ebenso mitreissend wie unerbittlich wirkte. So jedenfalls schilderte es mir mein akademischer Lehrer, der sich selbst als Student 1960 aus München aufmachte, um ein Semester lang vom Zürcher Ordinarius die Kunst der Interpretation zu lernen.
Der Literatur eine solche Geltung innerhalb der gesellschaftlichen Öffentlichkeit verschafft zu haben, erscheint mir heute als die vielleicht grösste Leistung. In diesem Sinn hat Emil Staiger eine ganze Generation von Germanisten geprägt. Diese öffentliche Stimme der Literaturwissenschaft hatte freilich auch ihre Schattenseite.
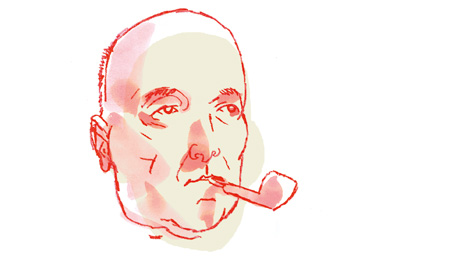
Staigers unselige Scheltrede auf die moderne Literatur im Zürcher Literaturstreit 1966 stempelte ihn zum Traditionalisten. Heute wird sein Werk zu Recht wieder entdeckt. Für mich ist beispielhaft, wie er die Aufmerksamkeit auf die Komplexität der Darstellungsverfahren der Literatur richtete. Er nannte diese Achtsamkeit auf die sprachliche Form «die Lust am Wert des Sprachkunstwerks» oder auch schlicht «Stil».
In der gegenwärtigen Debatte, ob der Literaturwissenschaft im Sog der allgemeinen Kulturwissenschaft ihr spezifischer Gegenstand abhanden komme, ist Staigers Beharren auf der spezifischen Kompetenz formbewusster Lektüre ein höchst aktueller Beitrag. Die Zürcher Germanistik hat heute noch ihre Identität in diesem Wissen um die sprachliche Vermitteltheit kultureller Wirklichkeiten.
Rüdiger Wehner, Emeritierter Professor für Neurobiologie schreibt über Ernst Hadorn: Die Entdeckung, dass frühe Organanlagen der Fliege Drosophila unter gewissen experimentellen Bedingungen ihre Bestimmungsrichtung ändern, also etwa statt Beinen Flügel oder Antennen bilden können – die Entdeckung der «Transdetermination» also –, brachte Ernst Hadorn (1902–1976), dem bedeutendsten Schweizer Entwicklungsbiologen seiner Zeit, Weltruhm ein.

Begonnen hatte er seine akademische Laufbahn 1931, als er – zuvor Primarlehrer – in Bern promovierte. Später arbeitete er als Rockefeller Fellow in den USA, wurde als Professor für Zoologie nach Zürich berufen, wurde Rektor der UZH und später Initiant des Forschungscampus Irchel, für den er sich bei der denkwürdigen Volksabstimmung von 1970 leidenschaftlich einsetzte.
Als Institutsdirektor war er – gewiss einer der alten Garde – vorbildlich: Er erkannte die Umwälzungen in den Biowissenschaften eher und schärfer als andere, sah das molekularbiologische Zeitalter heraufdämmern, etablierte an seinem Institut die Neuro- und Verhaltensbiologie und förderte – zum Beispiel in seinem legendären Literaturseminar – schon früh das Denken über die Fachgrenzen hinaus.
An uns Jüngere, die fasziniert in seinen Bannkreis traten, stellte er hohe Ansprüche. Er war hart, wo er es sein musste, und mild, wo er es durfte. Als ich ihn in meinem ersten Assistentenjahr einmal fragte, ob ich an den wöchentlichen Staff Meetings immer teilnehmen müsse, da ich im Labor so viel zu tun hätte, lächelte er hinter seiner Maispfeife: «Gehen Sie nur; ich sage Ihnen dann schon, was ich entschieden habe.» Er hatte immer recht entschieden.
Konrad Schmid, Professor für Theologie, schreibt über den furchtlosen David Friedrich Strauss: Die UZH wurde 1833 gegründet und stand sechs Jahre später bereits wieder vor ihrer Schliessung. Anlass dazu gab die Auseinandersetzung um den Theologen David Friedrich Strauss (1808–1874), der 1839 zum ordentlichen Professor für Kirchengeschichte und Dogmatik gewählt worden war.

Strauss war damals bereits wissenschaftlich ebenso berühmt wie in kirchlichen Kreisen berüchtigt für sein 1500 Seiten starkes Buch «Das Leben Jesu» (1835/36), das er als 27-Jähriger verfasst hatte und das die Evangelien nicht als Berichte über historische Tatsachen, sondern als deren mythologische Ausgestaltungen beschrieb. Zwar sei, so Strauss, Jesus in Nazareth aufgewachsen, lehrend im Land Israel herumgezogen und schliesslich aufgrund seiner Konflikte mit der Obrigkeit hingerichtet worden. Doch wurde dieses historische Gerüst in den Evangelien nachträglich breit ausgestaltet mit frommen Ideen und religiösen Interpretationen.
Auch wenn die heutige Bibelwissenschaft diesen Befund etwas anders analysieren und interpretieren würde, so gehört seine Grunderkenntnis, dass die Evangelien Historie mit späteren Glaubensaussagen des Urchristentums verbinden, zu den unhintergehbaren Grundlagen der modernen Theologie. Seine Berufung löste den «Züriputsch» aus, der zwar nicht die Universität, aber doch die Zürcher Regierung zu Fall brachte und nur durch die vorzeitige Pensionierung von Strauss, noch vor dessen Amtsantritt, beruhigt werden konnte. Strauss fand zeitlebens keine Anstellung mehr an einer Universität. Sein Name erinnert aber an die Notwendigkeit der Unabhängigkeit des Denkens von Dogmen, vorgefassten Meinungen, gängigen Überzeugungen und dergleichen. Dieser Unabhängigkeit müssen Wissenschaft und Universität verpflichtet sein, wenn sie ihrem Auftrag gerecht werden wollen.
Brigitte Tag, Professorin für Strafrecht, schreibt über die couragierte Brigitte Woggon: Sie war neben ihrem Hauptberuf als Professorin für Pharmakotherapie langjährige Präsidentin der Gleichstellungskommission (GLK) der UZH. Trotz ihrer Beteuerungen, dass ihr zumindest zu Beginn der Präsidentschaft das anvertraute Amt etwas fremd war, hat sie sich während ihrer mehr als siebenjährigen Amtszeit intensiv und engagiert mit der Gleichstellung befasst. Ihre offene, herzliche und bodenständige Art und ihre klaren Worte ebneten ihr den oft mühsamen Weg.

Während ihrer Präsidentschaft wurden namhafte Projekte realisiert; so wurde zum Beispiel das Bundesprogramm Chancengleichheit fester Bestandteil der Gleichstellungsförderung, der Anteil der Frauen an der UZH, insbesondere der Professorinnen, ausgebaut, die Kinderbetreuung forciert, die Gender Policy verabschiedet und implementiert und die Nachwuchsförderung zum Themenschwerpunkt der GLK erhoben.
Brigitte Woggon wurde 2008 mit dem Symposium Zivilcourage für ihre Verdienste in Sachen Gleichstellung geehrt und in den Unruhestand als Psychiaterin in ihre neu gegründete Praxis verabschiedet.
Georg Müller, Emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, schreibt über die erste Frau auf einem Lehrstuhl für öffentliches Recht in der Schweiz: Sie war und ist in jeder Beziehung ein Vorbild: Eine brillante Dozentin, didaktisch begabt und auf jede Stunde gewissenhaft vorbereitet; eine Rechtswissenschaftlerin der Spitzenklasse, die sich auf Grundsatzfragen des Verfassungsrechts konzentrierte, sie messerscharf analysierte und in präzisen, knappen und klaren Darlegungen Lösungen aufzeigte.
Ein Anliegen war ihr die Gleichberechtigung der Geschlechter, das sie ohne Pathos, aber konsequent und überzeugend vertrat. Sie wirkte nicht durch «feministische» Auftritte in der Öffentlichkeit, sondern schlicht durch ihren Erfolg als Professorin. Wir männlichen Kollegen hatten es nicht einfach neben ihr. Dass die Studentinnen ihre Lehrveranstaltungen den unseren vorzogen, konnten wir noch wegstecken. Aber auch die Studenten liefen in Scharen zu ihr über.

Dabei unterrichtete sie stets nüchtern und sachlich. Auf Showeffekte und Unterhaltung legte sie keinen Wert. Sie begeisterte die Studierenden ebenso wie die Wissenschaftsgemeinschaft mit ihrer stringenten Gedankenführung, ihren anschaulichen Erklärungen und überzeugenden Argumenten. Trotz all ihren Erfolgen ist sie bescheiden und zurückhaltend, jedem Personenkult abhold geblieben.
Laurenz Lütteken, Professor für Musikwissenschaft , schreibt über den Humanisten Paul Hindemith: Die Berufung von Paul Hindemith (1895–1963) an die UZH im Jahr 1949 war eine Sensation. Nicht nur gelang es auf diese Weise, den berühmten, im amerikanischen Exil lebenden Komponisten nach Europa zurückzuholen, bei einer erstaunlichen administrativen Elastizität. Vielmehr stellte seine Berufung einen nachdrücklichen Versuch dar, den Kunstwissenschaften im Sinne einer philosophischen Anthropologie neue Geltung zu verleihen. Der Komponist wehrte sich dagegen, die Wissenschaft von der Musik auf historische Quellenkunde zu reduzieren. Eine Kunstwissenschaft sollte, dies der Tenor der Zürcher Antrittsvorlesung von 1951, dem Menschen gelten und ihm dienen, auch und gerade in der differenzierten Aneignung der Geschichte.
Und er machte ernst damit: Es gab in Europa wohl keine einzige Universität, an der man 1957, wie in Zürich, eine Vorlesung über Schönbergs Streichquartette hören konnte. Nach seinem Tod und noch in den Achtzigerjahren galt er in den selbstverliebten Zirkeln einer vermeintlichen Avantgarde als Komponist «von gestern». Inzwischen jedoch erscheint das 20. Jahrhundert mit all seinen teleologischen Geschichtskonstruktionen auch in der Musik in einem anderen Licht. Hindemith gilt als einer seiner bedeutendsten Komponisten.

Die Provokation seiner Tätigkeit an der Universität Zürich, seiner unerbittlich am Menschen ausgerichteten musikalischen Wissenschaft ist, in Zeiten sich überschlagender Turns, Approaches und Strategien, aktueller denn je.